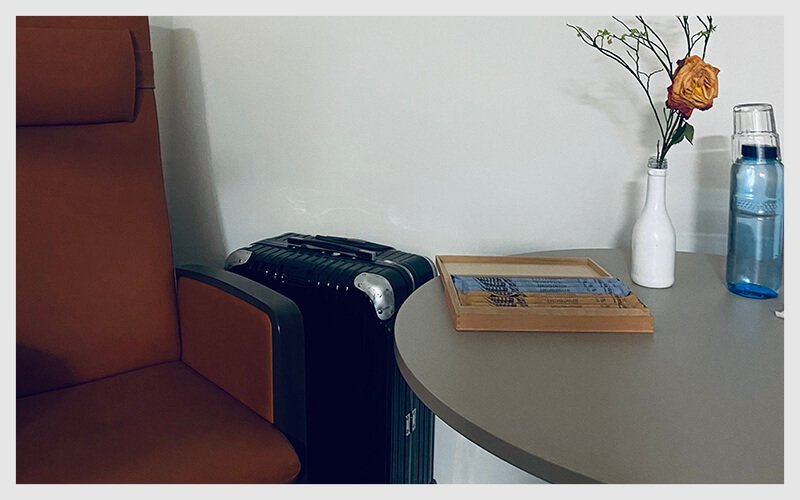Der Hund ist der beste Freund des Menschen – meine Nachtwache bei Herrn B.
Herr B. lag auf der Palliativstation und hatte einen ca. 30 cm großen Plüschhund bei sich im Bett. Die Pflegerin im Nachtdienst kuschelte den Hund die Nacht über immer wieder liebevoll zu Herrn B. hin, wenn er sich etwas verschoben hatte. Von diesem und weiteren Herzensmomenten, die zeigen, dass Begleitungen von Menschen, die sich auf den Weg zu ihrem Lebensende gemacht haben, keineswegs traurig sind, erzähle ich dir in diesem Blogartikel.
Meine Hospizbegleitungen waren allesamt regelmäßige Besuche einmal pro Woche, tagsüber oder Sitzwachen am Abend. Für meine erste nächtliche Sitzwache überlistete ich im wahrsten Sinne des Wortes meinen inneren Schweinehund.
Mit Proviant bepackt machte ich mich auf den Weg in das städtische Klinikum, als wäre ich auf dem Weg zum Wandern mit Freunden. Mit warmem Kräutertee, der mich beruhigend erdet und einer Brotzeit mit meinem selbst gebackenen Sauerteigbrot. In meiner bequemen Jogginghose, Kuschelpulli und einer Portion Neugierde betrat ich die Palliativstation und meldete mich bei der Krankenpflegerin, die in dieser Nacht Dienst hatte.
„Ah, wie schön! Hallo! Sie sind die Ehrenamtliche für Herrn B., richtig?“, entgegnete sie mir gleich sehr offen und warmherzig. Sie zeigte mir fürsorglich zuerst die Teeküche, den Kühlschrank mit dem Puddinglager, aus dem ich mich – Zitat: „auf jeden Fall!“ – bedienen sollte, und danach Herrn B.’s Zimmer.
Herr B. war am Tag zuvor auf die Palliativstation des Klinikums aufgenommen worden. Sein Zustand: sehr unruhig. Er hätte drei Tage später in eine Kurzzeitpflege verlegt werden sollen, was in diesem gesundheitlichen Zustand momentan nicht möglich schien.
Für unsere letzte Reise braucht es meist nur noch Handgepäck
Das Zielbild im Arbeitsumfeld einer Palliativstation umfasst die Symptomkontrolle und die Planung der Weiterversorgung im häuslich, familiären Umfeld, in einer Pflegeeinrichtung oder einem Hospiz. Aber auch die Sterbebegleitung, wenn die Zeit bereits vor Ort gekommen ist.
Der Hund ist der beste Freund des Menschen.
Ich nahm behutsam und leise den Besucherstuhl, setzte mich neben Herrn B. ans Bett und überblickte erst einmal die Situation: Herr B. lag auf dem Rücken in seinem Bett, links und rechts gut gepolstert mit weichen und formgebenden Kissen, zugedeckt mit einer Decke. Er schien für mein Empfinden vom Pflegepersonal gemütlich gelagert. Die Uhr zeigte 22 Uhr. Mein Dienstbeginn. Herr B.’s Augen wirkten abwechselnd wach schauend und unruhig dösend.
Er atmete schwer. Seine Atemzüge waren kurzatmig und flach keuchend. Etwas gehetzt, als wäre er in Eile zum Bus gerannt. In der Mitte seiner Atemzüge knisterte es. Das erinnerte mich an das Bitzeln des Kaktus-Eises, das ich in meiner Kindheit so gern mochte, weil ich das Knistern lustig fand.
Die Pflegerin schaute ins Zimmer und wechselte die Infusion, bevor sie uns im Zimmer wieder alleine ließ. Sie zupfte liebevoll noch die Bettdecke zurecht, streichelte Herrn B. an der Schläfe und brachte einen 30 cm großen, schwarz-braunen Plüschdackel warmherzig an seiner Schulter in die für uns von außen betrachtet optimale Kuschelposition.
„Der Hundilein ist wichtig.“, grinste sie mir entgegen. „Aber… ob er einen Namen hat, das weiß ich nicht.“
Wir schmunzelten.
„Herr B., hat der Hund einen Namen?“, fragte sie ihn.
Herr B. schüttelte leise den Kopf und grinste.
„Nicht? Sollen wir ihm denn einen geben? Oder kennen Sie den Hund vielleicht gar nicht?!“
Herr B. nickte bejahend mit dem gleichen leichten Grinsen wie beim Verneinen.
Den letzten beißen die Hunde.
Ich saß am Bett und sinnierte wartend wie sich die beginnende Nacht wohl entwickeln wird. 22:11 Uhr. Zuhause würde ich mich langsam schlafen legen, floss es mir durch den Sinn.
Zur Begrüßung erwähnte die Pflegerin, dass sie eigentlich zu zweit im Nachtdienst gewesen seien. „Ja gut, es ist ja immer jemand krank. So bin ich heute Nacht alleine für unsere Patient:innen da. Schön, dass ich mit Ihnen so eine nette Gesellschaft habe.“
Die Pflegerin ging in ihrem Stützpunkt ihren nächtlichen Aufgaben nach: Unterlagen raschelten, Schranktüren fielen ins Schloss, Medikamentenfläschchen unterbrachen klirrend die Stille der Nacht. Ich hörte Blumenwasser aus einer Gießkanne fließen und schloss kurz meine Augen. Ich atmete. Jetzt sitze ich also hier bei Herrn B. am Bett, meine erste Nachtwache, ließ ich meinen Gedanken freien Lauf.
Der Zeitabschnitt von der telefonischen Anfrage des Hospizdienstes bis zum Kennenlernen des Patienten scheint für mich oft wie aus der Zeit gefallen. Ich kenne den Namen – meist Vor- und Familienname –, die Krankheitssituation und manchmal noch das Alter. Aus diesen Parametern puzzelt sich mein Geist bis zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Begleiteten seine ganz eigene Reizwortgeschichte zusammen.
Diesmal lautete sie: Herr B., 85 Jahre, Aufnahme auf die Palliativstation am Vortag, Kurzzeitpflege ab Fr vermutlich nicht möglich, unruhig.
Die Zimmertür von Herrn B.’s momentanem Lebensraum stand weit offen. Das Flurlicht fiel in die Schwummrigkeit unseres gemeinsamen Seins. Es war mucksmäuschenstill. Man würde eine Stecknadel fallen hören, dachte ich mir. Über den leicht abgedunkelten Flur war aus einem anderen Zimmer ein seuselndes, weibliches Schnarchen wahrzunehmen. Ich grinste und freute mich innerlich, dass jemand seinen tiefen Schlaf findet.
Nachts auf der Palliativstation kann man die Stille hören
Hinter mir wehte der azurblaue, hauchdünne Baumwollvorhang leicht im nächtlichen Wind des gekippten Fensters. Die Zeit floss so dahin und außer meinem eigenen Herzschlag und Herrn B.’s knisterndem Atem hörte ich nichts. Nach 2 Stunden Sitzen, Atmen und Handhalten begann der Wind in der dunklen Münchner Nacht hörbar intensiver zu werden. Auch draußen passierte nichts – außer plötzliches Regentröpfeln auf das blecherne Fensterbrett des Klinikums, pfeifender Wind und ab und an war eine Rettungswagen-Sirene zu hören.
Hätte mir in diesem Moment jemand die Wette angeboten, ob die Zeit stehen geblieben ist, ich hätte bejaht. Nur die Infusion, die im gleichen Takt wie der Sekundenzeiger von Herrn B.’s Armbanduhr vom hängenden Beutel am Infustionsständer in das darunter befindliche Röhrchen tröpfelte, erinnerte mich daran, dass wir beide – Herr B. und ich – mit jedem unserer Atemzüge ein Schrittchen näher an unseren eigenen Tod kommen. Die Armbanduhr war unter dem blau-schwarz gestreiftem Pyjama-Oberteil versteckt. Vielleicht ganz gut so, dachte ich mir.
Schlafende Hunde soll man nicht wecken.
Herr B. döste. Während er abwechselnd leise schlief und keuchend atmete, bot ich ihm meine Hand an. Achtsame Berührungen sind eine Art der non-verbalen Kommunikation in der Begleitung von Menschen und geben Sicherheit. Sie stillen das Bedürfnis nach Geborgenheit.
Mein eigenes Bedürfnis etwas tun zu wollen, schlich sich immer mal wieder verstohlen an die Oberfläche meines Bewusstseins. In unserer Hospizbegleiter-Ausbildung lernten wir, dass wir diesem eigenen Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühl mit Präsenz und Atmen begegnen können. Mit dem Hand-Angebot konnte ich das Nichts-Tun unterstützen und doch eine Menge tun. Im Grunde musste ich ja „nur“ da sein.
Eine behutsame Berührung wird oft als sehr angenehm und aufrichtig erlebt
Es ist faszinierend, dass unruhige Menschen, die die angebotene Hand annehmen, nach einer Zeit merklich ruhiger werden. Ich beschrieb Herrn B. was ich tat: „Herr B., ich sitze hier und biete Ihnen jetzt meine Hand an. Vielleicht haben Sie das Bedürfnis nach ihr zu greifen. Wenn nicht, lassen Sie sie einfach links liegen. Ich bin jedenfalls da… Sie sind nicht alleine. Und wenn Sie etwas benötigen, dann machen Sie sich einfach bemerkbar und hole ich unsere liebe Nachtschwester.“
Meine Aufgabe für die heutige Nacht war präsent zu sein, da zu sein. Nicht aufzuwirbeln. So wie es An- oder Zugehörige aus ihrer emotionalen Verfassung heraus, unbewusst tun, weil sie ihren Liebsten nicht verlieren wollen oder die leidvolle Situation der Krankheit mit dem oft einhergehenden Ans-Bett-gefesselt-sein nur schwierig ertragen können.
Er musterte mich mit halbwachen Augen und schlummerte wieder weg. Ab und an riss mich ein knackender Atemzug und ein mittellautes Stöhnseufzen aus meinem eigenen Vor-Mich-Hinschauen. Und auch die leisen Schritte der Pflegerin, die gerade wieder ins Zimmer kam, um bei uns nach dem Rechten zu sehen. Sie stellte sich auf die gegenüberliegende Bettseite und beäugte prüfend die Situation. Herr B. wirkte angespannt, seine rechte Körperseite ein wenig steif.
„Herr B., haben Sie Schmerzen?“, sie legte dabei ihre blauen Gummihandschuh-Hände auf der weißen Bettdecke auf den Bereich ab, wo sich sein Bauch befand. „Im Oberschenkel? In den Beinen?“. Keine Antwort.
„Ihnen fehlt etwas, das spüre ich, aber Sie sagen mir nichts.“ Mehr mit sich selbst als mit Herrn B. sprechend fügte sie hinzu „Naja, ich krieg’s schon noch raus.“
Mit einem Mal hörte ich wieder die Armbanduhr ticken. Als wäre sie zuvor irgendwann stehen geblieben und hätte erst jetzt wieder angesetzt zum Weiterticken.
„Haben Sie Angst? – Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie sind nicht allein. Hier ist keiner hundeseelenallein. Keine Sekunde.“ Mit diesen Worten streichelte sie ihm mit einem noch nachgeschobenen, hauchenden „Es ist alles gut.“ fürsorglich die zersausten, grauen Haare glatt und blickte ihn noch einmal abschließend an. Danach mich.
„Letzte Nacht war er sehr unruhig, heute war es besser. Aber gut, dass du da bist.“ Ich freute mich über dieses winzige und doch sehr große, wertschätzende Feedback.
„Versuchen Sie ein bisschen zu schlafen, Herr B., damit Sie morgen wach sind, wenn Uta wiederkommt.“, sagte unsere liebe Fee, drehte sich um und verließ den Raum, um sich ihren anderen Patient:innen zu widmen.
Eine nächtliche Sitzwache erkennt die persönlichen Grundbedürfnisse
Ich blickte auf meine Handy-Uhrzeit und sah 1:32 Uhr. Wow, wie langsam die Zeit vergeht, dachte ich mir. Warum dauern Nächte, in Phasen, in denen ich ein sehr großes Schlafbedürfnis habe, nie so lange wie diese hier und heute? Vermutlich, weil ich einen Plan mit einer Zielvorstellung habe: nach der Nacht ausgeschlafen sein zu wollen. Oder zu müssen.
Heute war mein Plan: da zu sein. In Präsenz vergeht die Zeit scheinbar wirklich langsamer – es ist kein Märchen, wenn man in Zeiten mit großem Stress sagt „Die Zeit vergeht so schnell“. Die heutige Nacht lieferte mir den lebenden Beweis.
Wir drei haben Zeit: Herr B., der Plüschhund und ich.
Um 2:00 Uhr wurde Herr B. wacher. Er zupfte an seinem Pjyama-Oberteil, juckte sich hinter dem Ohr, fummelte an seinem weißen Oberlippenbart, nestelte an der Bettdecke und schaute dann mit eindringlichem Blick zu mir.
„Möchten Sie etwas, Herr B.?“, fragte ich ihn.
Mit einem tiefen Brummeln erzählte er mir in mehreren Sätzen etwas, das ich nicht verstand. Ich mutmaßte: „Möchten Sie etwas Trinken? Wasser?“ Er schüttelte mit dem Kopf.
Im gleichen Moment kam die Pflegerin wieder ins Zimmer und wartete mit mir ab. Wir glaubten, das Wort Kaffee verstanden zu haben.
Kaffee, um diese Zeit? Mitten in der Nacht? Naja, warum nicht? In der fürsorglichen, palliativen Pflege ist alles erlaubt, was schmeckt: Bier, Wein, Apfelschorle, Kaffee oder der Lieblings-Kirschlikör. Und wer sagt denn, dass es eine „richtige“ Tageszeit gibt, um Getränke zu konsumieren?!
Wir fragten erneut, um uns zu versichern: „Möchten Sie einen Kaffee?“. Herr B. blickte uns mit wachen, großen, glänzenden Augen an und nickte wie er die ganze Nacht noch nicht genickt hatte.
Unsere gute Fee ging in Richtung Teeküche, von wo ich einige Sekunden später das Rattern des Bohnen-Mahlwerkes hörte.
„Herr B., Sie sind mir ja ein Schlawiner, andere trinken nur frühmorgens Kaffee, weil sie 11 Stunden später nicht mehr schlafen können. Und Sie, Sie trinken nachts Kaffee, weil sie nachts nicht schlafen können.“ schmunzele ich ihm entgegen, während er immer noch erwartungsvoll mit aufgeregten Augen grinst.
Unsere Fee kam mit einer gelben Schnabeltasse voller warmem, duftendem Kaffee zurück ins Zimmer. Sie streckte Herrn B. mit einem liebevoll auffordernden Blick den warmen Becher entgegen und ließ ihn, mit einem Handtuch auf der Brust präpariert, behutsam Schlückchen für Schlückchen trinken. Mhm, wie das duftet.
Ich sprach von der anderen Bettseite zu ihm: „Herr B., morgen früh, wenn ich nach meiner Nachtschicht bei Ihnen dann ausgeschlafen habe und zuhause meinen Kaffee trinken werde, werde ich an Sie denken. Und daran, wie wir beide hier um 2:00 Uhr Kaffeekränzchen hatten. Hier bei Ihnen ist es schön.“
Herr B., unsere gute Fee, der kuschelige Hund, der warme Kaffeebecher und ich waren alles andere als Hund und Katz’ - unser 5er-Gespann war inzwischen ein eingespieltes Team geworden. Hier in unserem Nacht-Café.
Das Ziel einer Palliativstation umfasst die Symptomkontrolle und die Planung der Weiterversorgung im häuslich, familiären Umfeld, in einer Pflegeeinrichtung oder einem Hospiz. Aber auch die Sterbebegleitung, wenn die Zeit bereits vor Ort gekommen ist
So langsam werde ich hundemüde.
Es fühlt sich paradox an: während sich die ersten Stunden zogen wie ein ausgekauter Kaugummi, verging die Mitte der Nacht wie im Flug. Je näher es auf 4:00 Uhr zuging, desto hundemüder wurde ich. Als die Müdigkeit sodann auf ganz großen Pfoten angetrabt kam, setzte ich mich vom Stuhl, auf dem ich die ganze Nacht an Herrn B.’s Bettkante saß, um auf den zum „Liegestuhl“ umfunktionierbaren weinroten Sessel für An- und Zugehörige. Meinen Kopf lehnte ich müde an das Kopfpolster und atmete tief aus. Angenehm ist es hier bei Herrn B. in meiner ersten Nachtwache, dachte ich. Ich war dankbar, dass ich diese Nacht erleben und etwas von meiner eigenen Zeit schenken darf.
Während Herr B. glücklich und zufrieden mit seinen zwei Schlückchen Kaffee im Bauch in die entgegengesetzte Richtung an die andere Zimmerwand blickte und ich nicht mehr erkennen konnte, ob er die Augen geschlossen oder offen hatte, zückte ich mein Handy: 4:21 Uhr.
Ich googelte ziellos die Redewendung ‚hundemüde‘ und fand ratzfatz die Erklärung: Hunde haben einen Schlafbedarf von rund 18 Stunden pro Tag. Eigentlich ein ganz entspanntes Leben, denke ich mir und musste nun wirklich die Augen schließen, weil ich sonst vom Stuhl zu kippen drohte.
Was für ein Hundewetter!
Als ich eine Stunde später von einer zweiten Frauenstimme auf dem Flur der Palliativstation wach wurde und gleichzeitig den Regen auf dem blechernen Fensterbrett prasseln hörte, schoss es mir wie ein Blitz in meine Gedanken: ich hatte meinen Schirm zuhause vergessen. Hoffentlich hört es in einer guten Stunde auf zu regnen, wenn ich mich auf meinen Nachhauseweg begebe… Sonst komm ich daheim an wie ein nasser Hund.
So langsam fand meine nächtliche Sitzwache bei Herrn B. ein Ende.
Palliative Begleitungen sind oft ein Stillleben: das Arrangieren der Seele in einer liebevollen Umgebung
Viel ist in dieser Nacht nicht passiert – und doch eine ganze Menge. Nicht nur der Plüschhund hat sich eng an mein Herz gekuschelt, auch die liebevolle, fürsorgliche und offenherzige Art unserer Pflegerin im Nachtdienst. Und Herrn B.’s verschmitztes Schmunzeln, als er mit glänzenden Augen am Kaffeebecher zog.
Zuhause angekommen, legte ich mich schlafen und versuchte zum ersten Mal in meinem Ehrenamt mit einem völlig verschobenen Wach-Rhythmus klar zu kommen.
Und: ich freute mich auf meine duftende Tasse Kaffee, die ich ganz besonders genüsslich mit Erinnerungen an die letzte Nacht trank.